Hirnhautentzündung (Meningitis)
Was ist eine Hirnhautentzündung (Meningitis)?
Als Meningitis bezeichnet man eine Entzündung der Hirnhäute und der benachbarten Strukturen. Es handelt sich um eine ernste Erkrankung, die sich innerhalb von Stunden entwickeln und jeden – Kinder, aber auch Erwachsene – betreffen kann. Trotz medikamentöser Behandlung sind ein tödlicher Ausgang oder bleibende Folgeschäden nicht immer zu verhindern.
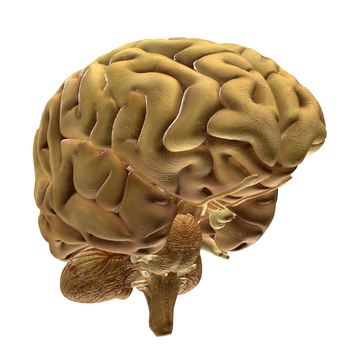
Verschiedene Erreger wie Bakterien (z.B. Borrelien, Meningokokken), Viren (z.B. Herpes-, Windpocken-, Mumps- Masern-Virus), Protozoen (Einzeller) und Pilze können die Krankheit verursachen, aber auch Autoimmunprozesse, Malignome oder Gifte können Auslöser sein.
Ursachen
Eine Meningitis kann durch Viren oder Bakterien verursacht werden. Häufige Erreger der bakteriellen Meninigitis sind vor allem Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Meningokokken und Pneumokokken.
Erreger können über die Schleimhäute der Atemwege, aber auch von einem angrenzenden Entzündungsherd (z.B. bei einer Mittelohrentzündung) oder einer Verletzungsstelle (z. B. offener Schädelbruch) aus einwandern. Im Frühjahr und Sommer besteht die Gefahr, dass durch einen Zeckenbiss die von Viren verursachte, so genannte Frühsommer-Meningo-Enzephalitis oder eine bakterielle Meningitis durch Borrelien übertragen werden.
In verschiedenen Altersgruppen können bestimmte Erreger/Auslöser überwiegen. So sind im Neugeborenenalter Herpes-Viren häufige Auslöser einer viralen Meningitis, während im Kleinkindalter u.a. Masern-, Mumps- oder Echovirus oft die Ursache für eine Erkrankung sind. Eine bakterielle Meningitis beruht im Säuglingsalter meist auf einer Infektion mit Streptokokken der Gruppe B, mit Escherichia coli oder mit Listerien. Im Säuglings- und Kleinkindalter werden Hämophilus, Meningokokken und Pneumokokken u.a. als die hauptsächlichen Verantwortlichen für eine Hirnhautentzündung genannt.
Symptome & Krankheitsbild
Ein wichtiges Krankheitszeichen einer Meningitis ist neben dem Fieber die Nackensteifigkeit. Das Kind setzt der Bewegung seines Kopfes einen Widerstand entgegen, so dass es kaum oder gar nicht möglich ist, den Kopf zum angewinkelten Knie des Kindes zu bringen (Meningismus). Weitere typische Krankheitszeichen sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erbrechen und Lichtscheu. Falls das Gehirn mit entzündet ist, kann es zu Benommenheit bis hin zum Koma kommen. Die Krankheitszeichen können sich binnen weniger Stunden entwickeln.
Bei Säuglingen treten meist andere, allgemeinere Beschwerden, wie Bauchschmerzen, Berührungsempfindlichkeit, Nahrungsverweigerung oder auch Krampfanfälle auf. Die Fontanelle kann vorgewölbt sein. Vorsicht: Gerade bei Säuglingen besteht die Gefahr, dass eine Meningitis zunächst übersehen wird, da sie sich manchmal sehr uncharakteristisch nur in Trinkschwäche und Schlaffheit äußert.
Wenn Sie derartige Krankheitszeichen bei Ihrem Kind feststellen, sollten Sie sofort einen Kinder- und Jugendarzt aufsuchen, damit gegebenenfalls umgehend eine Behandlung eingeleitet werden kann.
Auswirkungen
Generell sind die von Viren ausgelösten Hirnhautentzündungen nicht so gefährlich wie die bakteriell bedingten, z. B. die Meningokokken- oder Pneumokokken-Meningitis. In schweren Fällen kann eine Meningitis bleibende Schäden, wie Bewegungsstörungen, Hörschäden bis hin zur Taubheit oder Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung, nach sich ziehen oder sogar zum Tode führen. Kinder in den ersten drei Lebensjahren haben ein besonders hohes Risiko, an einer bakteriellen Meningitis zu erkranken.
Diagnose
Wenn der Verdacht besteht, wird der Arzt den Wirbelkanal punktieren (Lumbalpunktion) und daraus Nervenflüssigkeit (Liquor) entnehmen und sie untersuchen. Nur so kann er sicher feststellen, ob eine Meningitis vorliegt und ob es sich um eine Viren- oder Bakterieninfektion handelt.
Therapie
Meningitis erfordert häufig eine intensivmedizinische Behandlung im Krankenhaus. Wenn Bakterien die Verursacher sind, erhält das Kind Infusionen mit Antibiotika. Aber auch die Familienangehörigen des erkrankten Kindes müssen vorbeugend Antibiotika einnehmen, um sich selbst zu schützen.
Eine virale Meningitis kann nur symptomatisch behandelt werden, sie stellt jedoch im Allgemeinen keine so ernsthafte Erkrankung dar.
Impfschutz
Gegen einige Meningitis-Erreger kann vorbeugend geimpft werden:
So sind z.B. Impfungen gegen die Bakterien Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Pneumokokken und Meningokokken beim Baby möglich. Nicht selten ist eine Meningitis auch die Folge einer Mumps-Infektion. Auch gegen diese Infektionskrankheit kann geimpft werden, ebenso wie gegen den Erreger der Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME).
Adressen & Links
Konsiliarlabor für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr
Kompetenzbereich II "Viren & Intrazelluläre Erreger"
Neuherbergsstr. 11
80937 München
Internet: https://instmikrobiobw.de
Ansprechpartner: PD Dr. Gerhard Dobler
Telefon: 089 992692 – 3974 (PD Dr. Dobler)
089 992692 – 3980 (Prof. Dr. Zöller)
Telefax: 089 992692 – 3983
E-Mail: InstitutfuerMikrobiologie@Bundeswehr.org
GerhardDobler@Bundeswehr.org
Nationales Referenzzentrum für Streptokokken
aktuell nicht berufen
Nationales Referenzzentrum für Staphylokokken und Enterokokken
Robert Koch-Institut (Bereich Wernigerode)
FG 13 – Nosokomiale Infektionserreger und Antibiotikaresistenzen
Burgstraße 37
38855 Wernigerode
Internet: www.rki.de/nrz-staph
Ansprechpartner: Prof. Dr. Guido Werner (Leitung)
Telefon: 030 18754 - 4210 (Dr. Werner)
030 18754 - 4249 (Frau Dr. Layer für Staphylokokken)
030 18754 - 4247 (Dr. Klare für Enterokokken)
Telefax: 030 18754 - 4317
E-Mail: WernerG@rki.de
Quellen
- Robert Koch-Institut (RKI): Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2023. (27.1.2023) Epid. Bull 4, 2023. [PDF 11,30 MB, Acrobat Reader erforderlich]
- Robert Koch-Institut (RKI): STIKO: Standardimpfungen von Säuglingen gegen Meningokokken der Serogruppe B (18.01.2024). Epid. Bulletin 03, 2024. [PDF 1,39 MB, Acrobat Reader erforderlich]
- Robert Koch-Institut (RKI): Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2024 (25.01.2024). Epid. Bulletin 04, 2024. [PDF 3,7 MB, Acrobat Reader erforderlich]